Bei einer wissenschaftlich-geprägten, Schweizer Firma neulich: Fast alle Akademiker wollten ins Management. Nicht aus Leidenschaft fürs Führen. Sondern weil es der einzige Weg war, mehr zu verdienen und Anerkennung zu bekommen.
Das Resultat war absehbar: Brillante Fachleute wurden zu mittelmäßigen Managern. Sie verbrachten ihre Zeit mit Budget-Meetings statt mit der Forschung, für die sie ausgebildet waren und die sie begeisterte.
Show me the incentives and I’ll show you the outcome.
Unser Karrieresystem zwingt Menschen systematisch in Rollen, für die sie weder Talent noch Neigung haben. Wir belohnen Fachexpertise mit Personalverantwortung. Wir machen aus guten Ingenieuren schlechte Manager und nennen das «Karriere».
Die Lösung? Duale Karrierewege sind theoretisch bekannt, praktisch selten umgesetzt. Der Grund: Es reicht nicht, einen «Senior Expert Track» auf Papier zu schaffen. Solange Statusunterschiede, Gehaltsspannen und Entscheidungsmacht weiterhin an Führungsverantwortung gekoppelt sind, bleibt der Management-Track die einzig ernst genommene Option.
Die eigentliche Frage ist nicht: Wie designen wir bessere Karrieresysteme? Sondern: Wieviel Status und Macht sind wir bereit, von der Hierarchie zu entkoppeln?
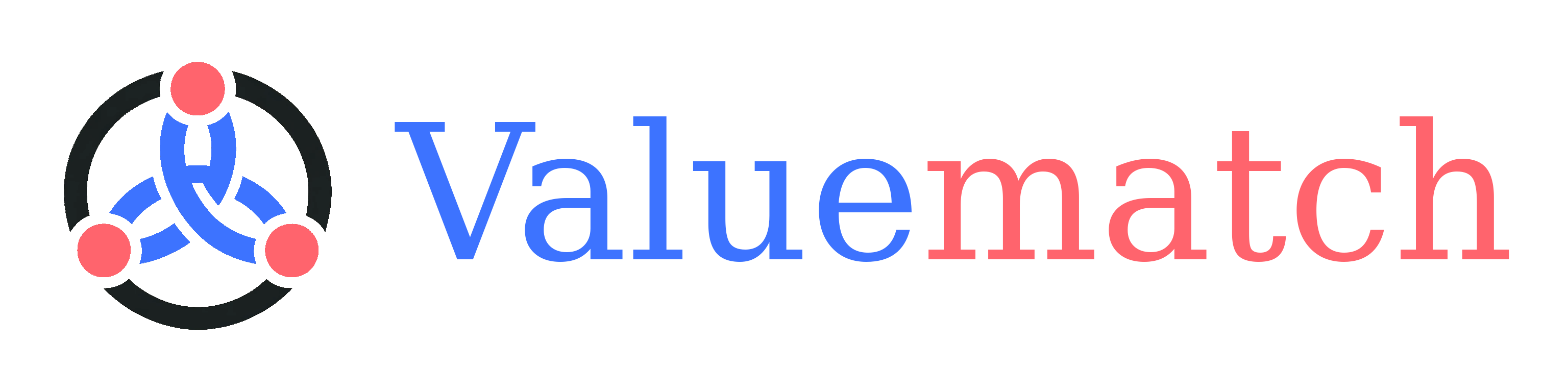

Ich freue mich über Kommentare mit Ideen, Einsichten, Feedback, Lob oder Kritik.