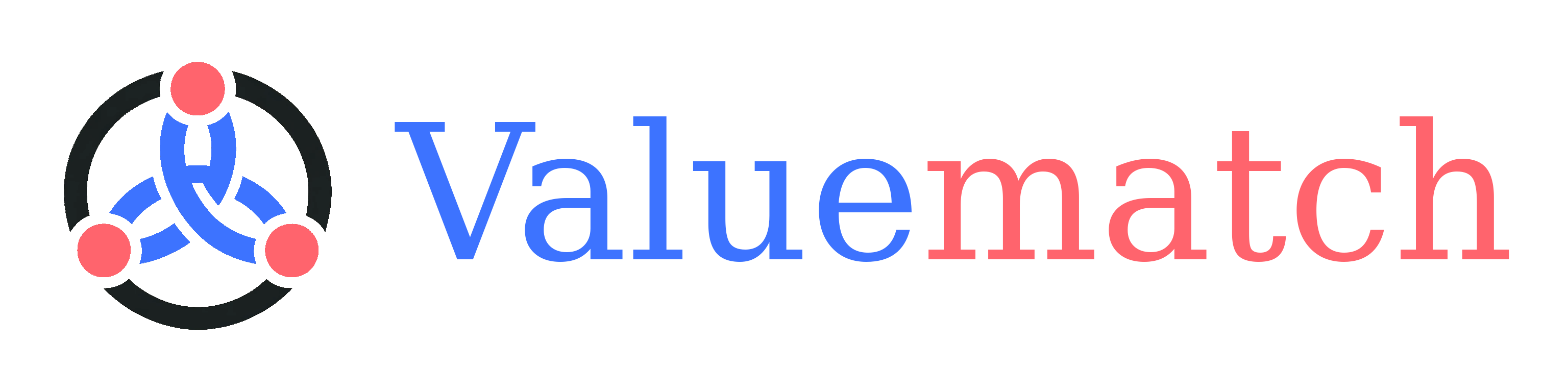Die verborgene Kehrseite moderner Gleichstellungspolitik – Erfahrungsbericht aus der Nagra
Während meiner Zeit als Projektmanager in der Abteilung Langzeitsicherheit bei der Nagra erlebte ich hautnah, wie sich das abstrakte Konzept der «Gleichentrechtung» im beruflichen Alltag manifestiert. Was als Befreiung der Frau begann, entwickelt sich zunehmend zu einem System, in dem beide Geschlechter denselben einseitigen Prioritäten unterworfen werden. Statt echter Wahlfreiheit erleben wir eine gleichmäßige Unterwerfung beider Geschlechter unter die Dominanz der Erwerbsarbeit – mit gravierenden Konsequenzen für Familienleben und persönliche Entwicklungschancen.
Die Schweiz als Fallbeispiel eines strukturellen Widerspruchs
Die Schweiz, oft als Vorzeigemodell für wirtschaftlichen Erfolg und Lebensqualität genannt, offenbart bei näherer Betrachtung ein System voller struktureller Widersprüche für Familien. Mit lediglich zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, 14 Wochen Mutterschutz und europaweit höchsten Kinderbetreuungskosten präsentiert sich ein Umfeld, das Familie und Beruf nicht als komplementäre, sondern als konkurrierende Lebensbereiche behandelt.
Bei der Nagra erlebte ich diesen Widerspruch in seiner vollen Ausprägung: Nach außen kommunizierte das Unternehmen Familienfreundlichkeit, doch als ich das Thema Familienplanung bei der Personalabteilung ansprach, war die Reaktion ernüchternd: «Nimm dir halt noch zwei Wochen Urlaub, wenn du willst.» Diese beiläufige Antwort offenbarte, wie wenig die aktive Vaterrolle im beruflichen Kontext anerkannt wird – ein blinder Fleck in der Unternehmenskultur.
Die sogenannte «Heiratsstrafe» – eine steuerliche Benachteiligung verheirateter Paare – verstärkt diese Problemlage zusätzlich. Diese Parameter bilden kein zufälliges Nebeneinander von Regelungen, sondern ein System, das bestimmte Wertsetzungen reflektiert: Die Priorisierung von Marktförmigkeit und ökonomischer Produktivität über familiäre Bedürfnisse.
Von echter Gleichstellung zur beidseitigen Anpassungspflicht
Die ursprüngliche feministische Forderung zielte auf gleiche Chancen und Wahlfreiheit ab – nicht auf die Verpflichtung aller zum identischen Lebensmodell. Was wir heute beobachten, ist eine ökonomisierte Version von Gleichstellung, die primär der Arbeitsmarktlogik folgt.
Diese Entwicklung manifestiert sich in mehreren messbaren Phänomenen:
- Die Doppelbelastungsnorm: Während früher Frauen zwischen Familie und Beruf entscheiden mussten, sehen sich heute beide Geschlechter dem Anspruch ausgesetzt, beides gleichzeitig perfekt zu bewältigen. In meiner Abteilung bei der Nagra nahmen männliche Kollegen maximal ein paar Wochen für Neugeborene in Anspruch – mehr wurde weder erwartet noch gefördert.
- Ökonomisierung familiärer Entscheidungen: Familiengründung wird zunehmend zur finanziellen Risikoabwägung, was demografische Konsequenzen hat. Die Geburtenrate in der Schweiz liegt mit 1,5 Kindern pro Frau deutlich unter dem Bestandserhaltungsniveau.
- Quantifizierung von Lebenszeit: Die Bewertung von Lebenszeit erfolgt primär nach wirtschaftlichen Maßstäben – Zeit mit Kindern wird zum «Produktivitätsverlust» umgedeutet.
Ein symbolisches Beispiel für oberflächliche Maßnahmen erlebte ich im sogenannten «Stillraum» der Nagra – tatsächlich eine umfunktionierte Abstellkammer, die während meiner Zeit bei der Nagra meines Wissens nach nie genutzt wurde. Dieses Schein-Angebot verdeutlicht das grundlegende Problem: Ohne strukturelle Anpassungen der Arbeitsorganisation bleiben solche Maßnahmen wirkungslos.
Die unausgesprochene Realität im Berufsalltag
Besonders aufschlussreich war die Beobachtung, dass Vereinbarkeitsprobleme unter Kollegen kaum thematisiert wurden. Es herrschte ein unausgesprochenes Einverständnis, dass Karriere und Familie in einem Spannungsverhältnis stehen – ein Thema, das man individuell zu bewältigen hatte, nicht als strukturelles Problem.
Die einzige positive Ausnahme, die ich erlebte, betraf eine Kollegin, die nach einer schwierigen Geburt mit Komplikationen viel Freiraum und Unterstützung erhielt. Dies zeigte: Im Notfall waren flexible Lösungen durchaus möglich – aber eben nicht als Normalfall, sondern als Ausnahme.
Zusammenfassen kann man sagen, dass die Gleichstellung nicht zu einer Aufwertung der traditionell weiblichen Tätigkeiten geführt hat, sondern zu einer weiteren Abwertung dieser Lebensbereiche für alle Geschlechter.
Der internationale Vergleich: Es geht auch anders
Der Blick über die Grenzen zeigt alternative Modelle, die Familie und Beruf nicht als Nullsummenspiel konzipieren:
Norwegen praktiziert ein System mit 49 Wochen Elternzeit bei vollem Gehalt, wobei ein substantieller Anteil explizit für Väter reserviert ist. Die Kinderbetreuungskosten werden staatlich subventioniert und betragen durchschnittlich nur etwa 15% des Schweizer Niveaus. Dieses Modell führt nicht zur wirtschaftlichen Katastrophe – im Gegenteil: Die Erwerbsbeteiligung von Frauen und die Geburtenrate sind höher als in der Schweiz.
Deutschland bietet flexible Elternzeitmodelle mit bis zu drei Jahren Karenz, wobei 14 Monate durch Elterngeld finanziell abgesichert sind. Die Steuergesetzgebung fördert Ehen ohne die Schweizer «Heiratsstrafe».
Österreich kombiniert Kinderbetreuungsgeld in verschiedenen Varianten mit einem gesetzlichen Kündigungsschutz während der Karenzzeit, der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf strukturell stützt.
Diese Länder zeigen: Die künstliche Dichotomie zwischen Familienorientierung und Gleichstellung ist kein Naturgesetz, sondern politische Entscheidung.
Die wissenschaftliche Perspektive: Qualität statt Quantität
Die Forschung zu kindlicher Entwicklung liefert wichtige Erkenntnisse jenseits ideologischer Debatten. Aktuelle entwicklungspsychologische Studien zeigen, dass Kinder vor allem verlässliche Bezugspersonen und Kontinuität benötigen – nicht aber notwendigerweise eine spezifische Geschlechterrollenverteilung. Die entscheidenden Faktoren für kindliches Wohlbefinden sind:
- Verlässliche emotionale Bindungen
- Stressfreie Umgebung für Eltern und Kinder
- Qualitativ hochwertige Betreuung – ob durch Eltern oder externe Betreuungspersonen
Problematisch wird es, wenn ökonomischer Druck Eltern in Situationen zwingt, die diese Faktoren untergraben. Laut Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie ist es nicht die externe Betreuung an sich, die potenzielle Probleme verursacht, sondern vielmehr unzureichende Betreuungsqualität aufgrund von Kostendruck sowie ein chronisch überlastetes Familiensystem.
Von der Gleichentrechtung zur echten Wahlfreiheit
Meine Erfahrungen bei der Nagra verdeutlichen, dass selbst in hochqualifizierten Bereichen wie der Langzeitsicherheit ein grundlegendes Umdenken nötig ist. Eine zukunftsfähige Familienpolitik müsste folgende Elemente integrieren:
- Flexible Elternzeitmodelle für beide Geschlechter mit substantieller finanzieller Absicherung
- Bezahlbare, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung als gesellschaftliche Infrastruktur
- Steuerliche Gerechtigkeit für Familien unabhängig vom gewählten Lebensmodell
- Arbeitszeitmodelle, die familiäre Verantwortung nicht als Karrierehindernis definieren
- Aufwertung von Sorgearbeit in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bewertung
Der Weg führt nicht zurück zu traditionellen Rollenverteilungen, sondern vorwärts zu einem System, das verschiedene Lebensentwürfe strukturell ermöglicht. Gleichberechtigung bedeutet Wahlfreiheit – nicht Gleichentrechtung unter dem Diktat des Marktes.
Eine gesellschaftliche Neuorientierung
Was als Emanzipation begann, droht in eine neue Form der Bevormundung zu münden – diesmal nicht durch patriarchale Strukturen, sondern durch die Absolutsetzung ökonomischer Imperative für alle Geschlechter.
Meine persönlichen Erfahrungen in einem technisch-wissenschaftlichen Umfeld zeigen, dass selbst in vermeintlich progressiven Organisationen tiefgreifende Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit bestehen. Die stillschweigende Erwartung, dass Männer ihre Vaterrolle den beruflichen Anforderungen unterordnen, spiegelt genau jene «Gleichentrechtung», die überwunden werden muss.
Eine zeitgemäße Gleichstellungspolitik müsste die Vielfalt menschlicher Bedürfnisse anerkennen und strukturell unterstützen. Dies erfordert ein Umdenken auf mehreren Ebenen – von der Steuergesetzgebung bis zur kulturellen Bewertung von Arbeit und Familie.
Die internationalen Beispiele zeigen, dass die Quadratur des Kreises möglich ist: Gesellschaften können wirtschaftlich erfolgreich sein und gleichzeitig Rahmenbedingungen schaffen, in denen Familie nicht zum Luxusgut oder Karrierehindernis wird. Die Schweiz mit ihrem hohen Wohlstandsniveau hätte alle Ressourcen, um hier eine Vorreiterrolle einzunehmen – es fehlt bislang am politischen Willen, die notwendigen strukturellen Veränderungen einzuleiten.
Die Überwindung der «Gleichentrechtung» wäre ein Gewinn für alle Geschlechter – und vor allem für die zukünftigen Generationen.